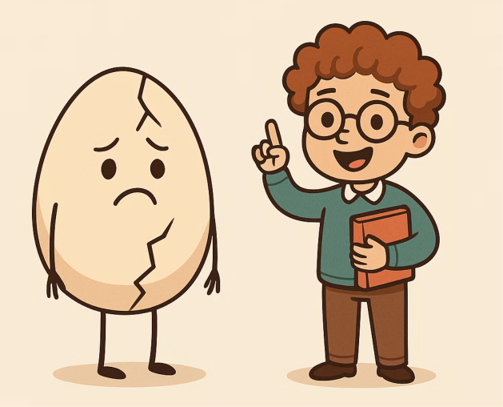Feinsinn trifft Führung – Was wir von Hochsensibilität im Arbeitskontext lernen können
Mimosa pudica, auch als Schamhafte Sinnpflanze bekannt.
„Ich wusste nicht, dass das einen Namen hat.“
„Das erklärt so viel, nicht nur bei mir, auch bei Menschen in meinem Team.“
„Ich dachte immer, ich sei einfach zu empfindlich.“
Diese Aussagen begegnen mir häufig in Coachings oder Workshops, wenn das Thema Hochsensibilität auftaucht. Die Phänomenologie bringt Herausforderungen mit sich, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit stören können. Und gleichzeitig eröffnet sie ungeahnte Potenziale, wenn wir uns erlauben, genauer hinzusehen.
Denn Hochsensibilität betrifft mehr Menschen in unserem Umfeld, als wir oft denken. Und sie ist nicht nur ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern auch eine Einladung für bewusste Führung. Denn sie bringt Stärken und Qualitäten mit sich, die für gelingende Zusammenarbeit und tragfähige Beziehungen essenziell sind.
Was bedeutet Hochsensibilität eigentlich?
Hochsensibilität ist kein Trend und keine Selbstdiagnose. Sie ist eine neurobiologisch fundierte Eigenschaft, die etwa 15–20 % der Menschen betrifft.
Hochsensible Personen nehmen Reize intensiver und differenzierter wahr und verarbeiten sie tiefer. Dabei sind die Sinneskanäle sehr unterschiedlich ausgeprägt – sehen, riechen, spüren, hören, schmecken, aber auch das Gleichgewichtsgefühl (vestibulär) oder die emotionale Resonanz.
Das schafft Diversität in der Wahrnehmung, ohne in Schwarz-Weiß-Typologien zu verfallen.
Wie zeigt sich das im Alltag?
Vielleicht kennst du Menschen, die:
feine Stimmungen und Zwischentöne in Meetings bemerken
schnell überreizt sind durch Lärm, Unordnung oder zu viele Gespräche gleichzeitig
intensive Pausen brauchen, aber gleichzeitig hoch kreativ und tiefgründig denken
Dann begegnet dir Hochsensibilität bereits, ob ausgesprochen oder nicht.
Was passiert im Gehirn hochsensibler Menschen?
Neurowissenschaftlich lässt sich das gut erklären: Hochsensible verarbeiten Reize in Hirnarealen wie der Insula (sensorische Integration) und der Amygdala (emotionale Bewertung) besonders intensiv.
Das bedeutet: Sie nehmen mehr wahr – und zwar früher, tiefer und oft vernetzter. Sie spüren Stimmungen, bevor sie ausgesprochen werden. Sie erkennen Details, die anderen entgehen. Und sie denken nicht langsamer – sie denken tiefer.
Was bei Überstimulation zu einer Überreizung mit hoher Anspannung bis hin zu körperlicher Übelkeit, Konzentrationsverlust, “innerem Gewitter” oder sogar zum Black-out führen kann.
Führung trifft Feinfühligkeit: Wo wird es schwierig?
In einer Arbeitswelt, die auf Tempo, Output und Sichtbarkeit ausgelegt ist, geraten Hochsensible schnell an Grenzen. Besonders introvertierte Menschen mit hoher Sensitivität ziehen sich zurück, wirken „zu sensibel“, „nicht belastbar“ oder „nicht durchsetzungsstark“.
Doch häufig ist das Gegenteil der Fall – wenn die Bedingungen stimmen.
Zeit für einen Perspektivwechsel
Gehen wir gemeinsam auf Tauchgang – entlang des Eisbergs unserer unbewussten Annahmen.
Was taucht da auf, wenn du an Hochsensibilität in der Zusammenarbeit denkst?
Konfliktscheu? Unprofessionell? Zu empfindlich? Eine Extrawurst?
Oder vielleicht einfach: Anders?
Hier lohnt sich ein kritischer Blick auf gängige Denkfehler – und neue Möglichkeitsräume:
Häufige Vorurteilen was Hochsensibilität betrifft
Verletzlichkeit oder Superpower? – Es kommt auf den Kontext an
Was viele überrascht: Hochsensible Menschen reagieren nicht nur stärker auf Stress – sie profitieren auch überdurchschnittlich von guten Bedingungen.
Die Forschung spricht hier von zwei Seiten derselben Medaille:
Vulnerability: Hochsensible zeigen bei Überlastung, Unsicherheit oder autoritärem Stil schnellere Erschöpfung.
Vantage Sensitivity: In unterstützenden Umfeldern zeigen sie mehr Leistung, Kreativität. Empathie und Kooperationsfähigkeit